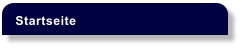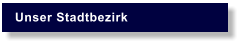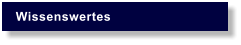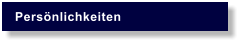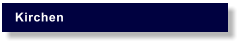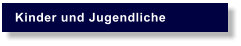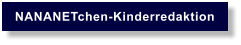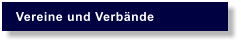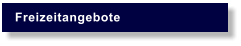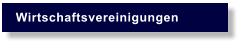© NANAnet Misburg-Anderten


Anderten - Einschulung 1947:
Acht Jahre soll ich zur
Schule gehen, das tue
ich nicht.
Bildbericht: Gisbert Selke
Henkelmann statt Zuckertüte
Acht Jahre soll ich zur Schule gehen, das tue ich nicht! Diese meine Feststellung am Ende des
ersten Schultages meinen Eltern gegenüber verhieß nichts Gutes. Mein Verhältnis zur Schule war
weder eine Liebe auf den ersten noch eine Liebe auf den zweiten Blick. Damit fiel ich aus dem
Rahmen, zumal mir meine drei Brüder als leuchtende Vorbilder in punkto Lernmotivation und
Strebsamkeit vorgestellt wurden. Noch heute überlege ich, warum mir meine hohen Erwartungen
an die Schule damals so gründlich verhagelt wurden. Woran konnte dies gelegen haben?
Bilder der Erinnerung tauchen auf: Ich sehe mich durch das gewaltige Tor zum Pausenhof gehen,
vor mir die Schule zwischen Langestraße und Krummestraße. Mama hatte mich fein gemacht, das
hieß, ich trug eine von meinen älteren Brüdern geerbte geflickte Hose, zu kleine Schuhe, ein
Hemd, dessen verschlissener Kragen gewendet war, damit es äußerlich ansehnlich wirkte. Meine
von Bekannten ausgeliehene Schiefertafel mit kleinem Schwamm und Griffel, die Dohrmann-Fibel
und ein Rechenbuch waren in einem von Opa auf dem Speicher lange Zeit eingemotteten und neu
mobilisierten, geflickten Sturmgepäck, einem „Affen“, aus dem Ersten Weltkrieg verstaut.
Zuckertüten gab es nicht, weder auf Bezugsschein noch unter der Hand oder geliehen. Dafür
bekam ich ein Kochgeschirr für die Schulspeisung, das meine Mutter mit selbst gemachten
Bonbons gefüllt hatte. Zur Dekoration hatte sie den Henkeltopf mit einem kleinen rot-weiß karierten
Tuch ausgelegt.
Wehmütig schaute ich auf die Klassenkameraden, die einen echten Ledertornister auf dem
Rücken trugen. Doch die Mehrzahl der Erstklässler hatte nicht einmal das Notwendigste für den
Schulalltag. Der Krieg war erst zwei Jahre zuvor zu Ende gegangen und viele hatten ebenso wie
wir im Bombenkrieg alles verloren, viele darüber hinaus ihre Heimat.
Beim „Setzt euch“ kullerten die Tränen
Gerne hätte ich einen Platz in der ersten Reihe der im Erdgeschoss befindlichen Klasse ergattert.
Andere waren schneller als ich, so dass ich in der zweitletzten Reihe Platz nehmen musste. Ich
war unglücklich. Meine Entscheidung war schnell getroffen: Acht Jahre sollte ich auf diese Weise
zur Schule gehen, das würde ich verweigern. Mit diesem Spruch schockierte ich meine Eltern,
meine Mutter bot ihr gesamtes pädagogisches Naturtalent auf, um mich zu beruhigen und
nachhaltig zu motivieren, es half nichts. Schule war und blieb für mich in erster Linie eine Last. An
diesem ersten Tag, dem 6. Mai 1947 muss für mich einiges schief gelaufen sein. Platz verpasst,
Platzenge, Platzangst – die Schülerzahl unserer Klasse war zu groß für diesen Raum. Wir konnten
uns nicht „entfalten“, wie man in modernem Pädagogenchinesisch sagt. Ich wollte hier so schnell
wie möglich wieder raus, deshalb auch die schockierende Mitteilung an meine Eltern: Acht Jahre
soll ich zur Schule gehen, das tue ich nicht. Ich habe am ersten Schultag geweint.
Sicherlich waren wir damals gleichermaßen gespannt wie die Erstklässler heute und bestimmt
ebenso fröhlich. Dennoch machten wir insgesamt einen abgerissenen Eindruck. Mit welcher
Kreativität hatten uns unsere Mütter herausgeputzt: Liebevoll geflickte Hemden und Hosen,
sauber, aber vielfach vererbt. Manches Kleidungsstück war „noch etwas vollkommen“, will sagen,
es war viel zu groß. Strümpfe durften wir nur dann anziehen, wenn es kalt wurde.
In warmen Wochen mussten sie geschont werden. Jungen trugen „Weiber“-Leibchen, damit die
langen Strümpfe durch Strapse gehalten werden konnten. Da es nichts anderes gab, trug ich
zwangsweise dann und wann den einen oder anderen rosafarbenen Schlüpfer. Das war für einen
Jungen damals schlimmer als aus Mangel an geeigneten Schuhen barfuß laufen zu müssen; an
der stinkenden schwarzen Pinkelrinne wurde man von den Großen gnadenlos und demütigend
gehänselt.
Zehn Packen weniger neun Packen sind ein Packen
Unser erster Lehrer Friedrich Lohmann muss - rückschauend betrachtet - ein sensibles
pädagogisches Händchen gehabt haben, denn Tag für Tag entdeckte ich mein Herz für die Schule
stärker. Spaß hatte ich dennoch nicht daran. Wenn ich heute über den Kronsberg gehe, sehe ich
Friedrich Lohmann, den sie den Langen nannten, deutlich vor mir. Er weckte dort oben in uns die
Sehnsucht, unsere Umgebung wie z. B. die nahen Bergketten Benther Berg, Gehrdener Berg,
Deister oder Osterwald kennen zu lernen. Er erläuterte uns die zerstörten Reste der alten
Stadtsilhouette Hannovers.
Dort oben lernten wir, warum es Kali-Abraumhalden gab und weshalb die Hindenburgschleuse
gerade in Anderten gebaut worden war. Er brachte mit bewundernswerter Geduld unsere große
Klasse so nachhaltig zur Ruhe, dass wir nicht nur sahen, wie sich die Lerchen mit dem ihnen
eigenen Flattern in die warmen Frühlingslüfte erhoben, wir konnten ihrem Gesang lauschen und
sie beobachten. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Grundschüler von heute fähig sind, die
gleiche Sensibilität zu entwickeln, wie wir sie damals hatten.
Lieder wie „Die güld’ne Sonne ...“ oder „Geh’ aus, mein Herz und suche Freud ...“ gehen mir durch
den Kopf. Ich höre uns singen, „Wer will fleißige Handwerker sehn ...“ und habe bis heute nicht
vergessen, dass „zehn Packen weniger neun Packen ein Packen (Einpacken)“ sind.
Unterricht vom Feinsten
Naturtalente wie Friedrich Lohmann würden die schnelllebige und in hohem Maße Medien
gestützte pädagogische Atmosphäre einer modernen Schule von heute vielleicht nur
achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Da es aber nach dem Zweiten Weltkrieg keine
Unterrichtsmittel gab, waren alle Lehrkräfte gezwungen, uns „vor Ort“ zu führen. Wir erlebten
unsere Umwelt realiter und lernten sie nicht über Secondhand-Medien kennen. Wir beobachteten
die Natur, ohne sie gleich zu schädigen oder gar zu zerstören. Dies war Unterricht erster Sahne.
Davon profitiert zu haben, kann und soll uns stolz machen, denn wir haben gelernt, wie man lernt,
entdeckt, beobachtet, schützt und hegt.
Eine auf dem kleinen Schulhof an der Krummestraße im Verlauf des Unterrichts errichtete
Sonnenuhr bauten wir am Nachmittag zu Hause nach und „eichten“ sie am verlässlichen Schlag
der Kapellenuhr. Unsere erste bewusst miterlebte Sonnenfinsternis betrachteten wir durch kleine
von Friedrich Lohmann mit einer Haushaltskerze geschwärzte Fensterglasscherben. Unvergessen
bleibt mir, wie Friedrich Lohmann die Niedersachsenkarte freihändig und mehrfarbig auf die
Wandtafel zeichnete. So prägte sich die Wesernase bei Polle ebenso ein wie die bräunlich
hervorgehobenen niedersächsischen Höhen, z. B. der wie ein Handstock geformte Ith zwischen
Elze und Hameln, der wie ein Ohr aussehende Hils bei Eschershausen oder die Sieben Berge bei
Alfeld und der sich auf der anderen Seite der Leine ausbreitende Sackwald.
Mit einem Sonderzug der Straßenbahn fuhren wir 1949 quer durch das zerstörte Hannover, weiter
über Empelde, an den Sieben Trappen vorbei, durch Gehrden bis Barsinghausen. Die
anschließende Wanderung führte zum Nordmannsturm, der Alten Taufe und schließlich nach
Egestorf, wo uns der Sonderzug der Straßenbahn wieder erwartete. Regelmäßig lasen wir im
Niederdeutschen Lesebuch und lernten zahlreiche Sagen der niedersächsischen Heimat kennen:
Die sieben Trappen, der Rattenfänger zu Hameln, die Lüneburger Salzsau, die Entstehung
Hildesheims und viele andere. Unvergessen ist mir noch heute die Kurzgeschichte das Abenteuer
auf der Eisenbahn.
Lohmann setzte ein damals noch modernes Medium, den 16 mm Stummfilm, ein, dessen bewegte
Bilder insbesondere bei den Märchenfilmen von ihm sprachlich perfekt begleitet wurden. Die
Bildungspäpste des 21. Jahrhunderts definieren diese Form des Lehrens heute sicher nicht als
moderne Wissensvermittlung, „gute Schule“ war dieser Unterricht dennoch.
Keine der uns unterrichtenden Lehrkräfte war damals auf Rosen gebettet. Die geringe Höhe der
damaligen Lehrerbesoldung sollte man auch heute noch schamhaft verschweigen. Trotzdem
strahlten alle ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber Zuversicht aus und halfen so mit
einfachsten aber wirksamen pädagogischen Mitteln über den oft quälenden kindlichen
Weltschmerz hinweg. Aber auch uns Sechsjährigen fiel auf, dass die Kleidung unserer Lehrkräfte
ähnlich verschlissen und vielfach geflickt war wie die unsere.
Kindheit zwischen Stoppeln, Kleinvieh und Rübenschnaps
Als ABC-Schützen und Grundschüler erlebten wir das Kalenderjahr noch als Klimaphänomen,
froren und schwitzten, sahen die Saat aufkeimen und machten aus den Erntewochen eine
Abenteuerreise. Das „Stoppeln“ von Ähren, Kartoffeln, Zuckerrüben und anderen Ernteresten war
Teil unserer jahreszeitlichen Pflichten. Aus mühsam in der Gaim oder im Bockmer Holz
gesammelten Bucheckern wurde einfaches Speiseöl gepresst, aus Wildbeeren schmackhafte
Marmelade gekocht. Wir Kinder durften beim Herstellen von Rübensaft vorweg schon mal den
„Schaum“ schlecken. Die Destillation von Rübenschnaps dagegen unterlag strengster
Geheimhaltung, denn illegale Schnapsbrennerei wurde auch damals hoch bestraft. Die
Erwachsenen wussten, dass sie vor Kindermund nicht sicher waren. Dennoch wurde die im
Verborgenen produzierte qualitativ eher miserable Droge zum Erfolgsrezept für so manche
ausgelassene Feier unter Verwandten und Bekannten, die auf diese Weise für kurze Zeit alle
persönlichen Schicksalsschläge, Existenzängste, Sorgen und Belastungen verdrängen konnten.
Familienfeiern wurden in der „schlechten Zeit“ pünktlich gegen 18.00 Uhr unterbrochen, damit
Gäste und Gastgeber Gelegenheit zum Füttern der Schweine, Hühner oder Kaninchen hatten.
Später ging es laut und lustig weiter. Wir Kinder hielten uns aufmerksam zuhörend im Hintergrund,
denn hier wurde über erlebte Zeitgeschichte berichtet, lebendig erzählt und für uns Kinder konkret
erfassbar.
Das gebündelte Leid des Krieges und des darauf folgenden Zusammenbruchs fokussierte sich
exemplarisch in den Lebensläufen der eigenen Verwandten und Bekannten. Jede Familienfeier
entwickelte sich so zu einer spannenden Lehrstunde in Sachen Lebensbewältigung.
In der Rückschau muss ich neidvoll feststellen, dass die uns nahe stehenden Menschen, in deren
Beziehungsnetzwerk wir Kinder eingeflochten waren, zwar mühevoll ums tägliche Überleben
kämpften, aber sie sprachen miteinander und schwiegen nicht aneinander vorbei. Sie gaben von
dem Wenigen, das sie besaßen, ab und stellten nicht erst eine - heute vielfach übliche - Gewinn-
und Verlustrechnung auf. Sie waren sicher, dass Hilfe in der Not auf Gegenseitigkeit beruht. Damit
wurde Solidarität praktiziert, lange bevor der Begriff politische Vokabel wurde.
Ich möchte nicht missverstanden werden: Die Nachkriegsjahre und die erste Schulzeit waren für
uns erbärmlich. Wir erlebten dies vielleicht subjektiv anders, weil wir keine Vergleiche zu besseren
Zeiten ziehen konnten. Wir Kinder blickten in die verhärmten und ausgemergelten Gesichter von
Vater und Mutter und verstanden auf kindliche Weise. Wir spürten auch etwas von der Trauer,
wenn Klassenkameraden gestanden, ihr Vater sei gefallen oder vermisst.
Dörfliche Spiel- und Erlebniswelt
Dennoch leuchten die Bilder der Erinnerung in hellen, warmen Farben: Welche Freiheiten konnten
wir für uns nutzen?! Unser Erlebnisbereich erstreckte sich vom Tiergarten im Westen bis weit in die
Rothwiesen im Osten, von den „Drei Brücken“ im Norden bis zur Gaim im Süden.
Die damals noch durch die bäuerlichen Strukturen geprägte Welt Andertens gab uns Gelegenheit,
Ackerbau und Viehzucht mitzuerleben. Im Winter banden wir unsere Schlitten an den mächtigen,
von sechs Pferden gezogenen hölzernen Schneepflug, der im Sommer neben dem Spritzenhaus
stand und dann in unserer Spielphantasie zum Segelschiff oder Ozeanriesen mutierte. Gemütlich
ließen wir uns im Schlepptau durch den verschneiten Ort ziehen. Ein anderes Mal zockelten wir als
Anhängsel eines mit dampfendem Mist beladenen Pferdeschlittens über den Kronsberg.
Für uns Erstklässler geriet das „Eintauchen“ in die gegen Abend von den Brachen zurückkehrende
und auf dem Prüße-Hof beheimatete Schafherde zur absoluten Mutprobe. Der Unterschlupf in
einer aus mächtigen Garben gebauten Stiege vermittelte uns für Momente, ein eigenes Dach über
dem Kopf zu haben.
Wenn Frau Henzel, die Totenfrau im Dorfe, gerufen wurde, war Trauer angesagt, insbesondere an
jenem 12. August 1947 als unser Klassenkamerad Matthias Lendzian auf der Höverschen Straße
von der Deichsel eines fahrenden Wagens rutschte und tödlich überfahren wurde.
Tote wurden zu Hause aufgebahrt oder im Einzelfall in der Leichenkammer am Spritzenhaus
abgestellt und am Begräbnistagtag mit dem von zwei schwarzen Pferden gezogenen
Leichenwagen zum Friedhof an der Ostfeldstraße überführt. Dann läutete die Glocke im Turm der
Kapelle; die Bewohner des Dorfes hielten für kurze Zeit inne oder folgten dem Leichenwagen in
stiller Prozession zum Friedhof.
Niemand starb damals anonym und blieb deshalb auch in Erinnerung.
Bekanntmachung! - Immer, wenn der Gemeindediener Steffen auf seinem Horn blies und
Bekanntmachung rief, gab es etwas Wichtiges auszurufen. Wenn die Obrigkeit ihren Bürgern
etwas mitteilen wollte, geschah dies auf die beschriebene Weise, denn ein Radio kannten nur
wenige und das Fernsehen war noch nicht eingeführt. Wer keine Zeitung abonniert hatte, befand
sich im Tal der Ahnungslosen. Eine weitere wichtige Funktion bei der Bekanntgabe amtlicher
Angelegenheiten hatte der Aushang an der Gemeindeverwaltung. Nachrichten wurden häufig auch
über die Schule verbreitet. Telefone bildeten im Dorf die absolute Ausnahme und mehrfach pro Tag
erhielten wir Kinder den Auftrag, private Nachrichten zu übermitteln. So lernten wir früh,
Verantwortung zu übernehmen.
Vom Schulverächter zum Schulinteressierten
Sicherlich beurteilt jeder meiner Klassenkameraden die Erlebnisse während der ersten Schuljahre
anders und muss für sich selbst entscheiden, ob er eher positiv oder eher negativ geprägt wurde.
Wenn ich zurückschaue, wird mir immer klarer, dass ich in Friedrich Lohmann einem Lehrer
begegnete, der mir die Welt des schulischen Lernens erschloss. Andere, die mich neugierig
machten, folgten und auf diese Weise wandelte ich mich vom Schulverächter zum
Schulinteressierten. So erkannte ich, dass Schule Spaß machen kann – nicht nur für Schüler,
sondern auch für Lehrer. Unbestritten beeinflusste dies meine Entscheidung, Lehrer werden zu
wollen. Dass ich als Schulleiter einmal an den Ort zurückkehren würde, in dem meine
Schulkarriere 1947 begann, hätte ich mir auch in den kühnsten Träumen nicht vorzustellen
vermocht.
Erinnerungen zum Weitersagen
Richte ich heute meinen Blick über den ehemaligen Schulhof auf das alte Gebäude an der
Langestraße, habe ich die erlebte Vergangenheit wieder klar vor Augen: Fröhliche, wenn auch
abgerissene kleine Schüler drängen sich durch das mächtige Tor. Kleine Schwämmchen baumeln
an Fäden oder Bändern aus dem Tornister oder aus dem Behältnis, das den Tornister ersetzen
muss. Beim Laufen klappern nicht nur Schiefertafel und Griffelkasten gegeneinander, auch das
Feldbesteck im Kochgeschirr für die Schulspeisung scheppert rhythmisch mit.
Neben der in grobes Packpapier eingebundenen Dohrmann-Fibel befinden sich im Tornister bzw.
in der Schultasche manchmal auch ein wenig Fallobst oder eine Scheibe Brot mit Margarine und
Gurkenscheiben darauf. Moderne Vitaminspritzen, überflüssige Wunderdrinks und dick machende
Wunderriegel sind noch nicht erfunden. Wer Durst hat, trinkt Wasser oder Tee.
So barg selbst der ungeheure Mangel dieser Zeit etwas Soziales in sich. Der Kleiderterror mit Hilfe
einschlägiger textiler Nobelmarken und aggressiver, greller Werbesignale der immer verrückter
werdenden Konsumgesellschaft wäre im Zeitalter der Mangelwirtschaft der Nachkriegszeit
undenkbar gewesen. Wohlstand und Überfluss als Begriffe gehörten damals nicht zu unserem
Wortschatz.
Unser positives Sozialverhalten entwickelte sich trotz der offensichtlichen Armut. Auch das
Geringste hatte seinen Wert, den es zu achten galt, auch gestopfte Strümpfe erfüllten ihren Zweck.
Wurden sie beim Spiel leichtfertig zerrissen, war der Schaden nachhaltig, denn es gab nichts
Neues, es wäre auch nicht bezahlbar gewesen. Wir „kungelten“, d. h. wir entwickelten uns zu
Meistern des Tauschhandels, bei dem es verpönt war, den Kameraden leichtfertig über das Ohr zu
hauen.
Damals wurden wir geprägt. Dadurch haben wir der jüngeren Generation viel voraus.
Hochmut? – keine Spur.
Selbstbewusstsein? – Na klar!
In Anderten erlebte ich die schönsten Jahre meiner Kindheit. Nach Anderten kehrte ich im Sommer
2004 als Leiter der Pestalozzischule II zurück. Mit Ablauf des Schuljahres 2005/2006 wurde ich in
den Ruhestand versetzt. Ich habe meinen Beruf geliebt.
"Acht Jahre soll ich zur Schule gehen, das tue ich nicht!“ Mit dieser Feststellung bereitete ich
meinen Eltern im Mai 1947 ernsthafte pädagogische Probleme. Aus den acht Schuljahren wurden
schließlich fast sechzig.
„Herr Selke, erzählen Sie uns etwas ‚von früher’!“, baten mich meine Schülerinnen und Schüler in
so mancher Vertretungsstunde und so erzählte ich. Häufig fragen ältere Menschen resignierend:
„Wen interessiert das, was ich einst erlebte, heutzutage noch?“
Unser Leben bietet jungen Menschen reichlich Stoff.
Erzählen wir!